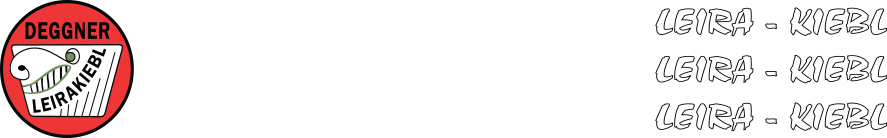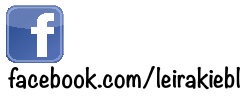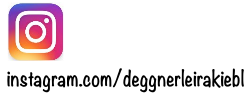Alfons Almendinger, * 1914, Konrektor, Deggingen über das obere Filstal
Die Gemeinde Deggingen liegt im oberen Filstal, eingerahmt vom Degginger Hausberg der Nordalb (Sommerberg), dem Galgenberg im Bereich der Hochalb dem Weigoldsberg und südlich des Tales dem Tugstein (Ave-Berg) und der Südalb oder Bernecker Berg mit dem Oberbergfelsen. Von vier markierten Felsen bzw. Bergrücken grüßen weit sichtbare Feldkreuze herab ins Tal und erinnern, dass diese in christlicher Gesinnung dort oben errichtet worden sind. Die Wallfahrtskirche „Ave Maria“ auf halber Höhe am südöstlichen Bergabhang zieht seit Jahrhunderten große Scharen von Pilgern und Marienverehrern zu sich herauf. Etwas bescheiden: vom Baumwuchs fast versteckt, grüßt vom Bernecker Berg die Buschelkapelle herab. Sie ist Privatbesitz von drei Bernecker Hofstellen, die wiederum einst zum Hofgut der heute abgegangenen Burg Berneck, dem Sitz der Herren von Deggingen, zählten.
Im ganzen oberen Filstal waren im wahrsten Sinne des Wortes die Geißen zu Hause, da her auch die Bezeichnung „Geißentäle“. In dem engen, abgelegenen Tal gab es früher wenig zu bewirtschaftende Felder und wenig größere Bauernhöfe. Wiesen und Bergwiesen überwogen und bildeten die Grundlage für Kleinbauern und Einzelhaushalte. Fast in jedem Haus befanden sich im unteren Eingangsbereich kleine Ställe für Haustiere, meistenteils für Ziegen, hier Geißen genannt, deren Futter von eben diesen kleinen Wiesen und Feldern stammte, die meistens von den Frauen bewirtschaftet wurden. Noch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zog der „Goißahirt“ mit seinem Blasinstrument in aller Frühe durch das Dorf. Aus den Ställen wurden die Geißen freigelassen, sie folgten dem Hirten in großen Scharen, der sie wie der Schäfer um sich sammelte, auf die Weide am Berghang führte, dort den Tag über hütete und sie am Abend ins Dorf zurückbrachte. Erst 1903 mit dem Bau der Tälesbahn – Täleskätter nannte man das schnaubende Zügle – wurde das Täle für den Verkehr und auch für die Industrie erschlossen. Vorher wohnten hier neben den vielen Kleinbauern die Spindeldreher, die Maurer und Gipser. Letztere zogen im Frühjahr hinaus in alle Lande, um dort ihr Brot zu verdienen, teils aber auch, um sich groß heraufzuarbeiten. In vielen süddeutschen Städten haben es manche als Stuckateurmeister in eigenen Betrieben zu viel Anerkennung und Ansehen gebracht. Die anderen kehrten jeweils im Herbst zurück zu ihren Familien, um während des Winters in anderen Berufen. z. B. als Holzmacher oder als Flickschuster, die Winternahrung für sich und ihre Familien zu verdienen. Ein besonders hervorragendes Gewerbe hat sich im ganzen 19. Jahrhundert bis hinein in dieses Jahrhundert entwickelt, nämlich das Gewerbe der Feinmechanik, sprich Schröpfkopfmacher. 1835 beschäftigten sich hier mit der Fabrikation von „Schröpfköpfen“ und „Aderlaßeiselein“ neun Meister mit zwei Gesellen. Diese Familien- betriebe fertigten im Jahre rund 2000 Stück dieser Art, die zeitweise persönlich in den europäischen Städten Paris, Warschau, Wien, Leipzig. Frankfurt/Oder und vielen an deren Orten vertrieben wurden. Namen wie Fröhle. Abele, Scherrbacher, Hagenmaier waren mit diesem Gewerbe der Feinmechanik verbunden. Manche brachten es zu großem Ansehen in der Gemeinde und zu bescheidenem Reichtum. Der eine oder andere der Schröpfkopfmacher konnte seine Tochter bei der Verheiratung mit einer Mitgift auf „ein Säckchen Gold“ stellen. Die Tälesleut untereinander nahmen sich mit folgendem Spottvers auf die Schippe: Wiesastoig – a schena Stadt, Mühlhausa – mit`m Maltersack, Gauschba – leit em Grond, Ditzabach – hot baise Hond, Deggna – mit`m Leirakiebl, Reichabach – d`r Deckl driebr, Hausa mit`m Riabaloch ond weidr nah isch`s Deiflsloch!
Maria Knaupp, * 1905, Hausfrau, Deggingen
Gipser in der Fremde
In meiner Kindheit gab es noch fast kein Auto auf den Straßen zu sehen, und aus jeder Quelle konnte man klares Wasser trinken. Auf den Wiesen aßen wir Wiesenbocksbart, Guckauga, Sauerampfer und Hasenklee. Die Buben schmierten sich mit dem Wiesenbocksbart ein und sahen danach im Gesicht und an den Händen schwarz wie Mohren aus, denn sie wollten dadurch ihren Bart andeuten. Mein Vater Josef Knaupp war von Beruf Gipser und verdiente sein Geld im Allgäu. Dort bei Kempten hatte der Degginger Gipsermeister Hagenmaier ein Gipsergeschäft eröffnet und ermöglichte seinen Kollegen, den Sommer hindurch bei ihm zu arbeiten. Seine schmutzige Kleidung schickte mein Vater im Wäschesack nach Hause, und wir Kinder freuten uns besonders. wenn zwischen den Hosen und Hemden eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Bonbons für uns hervorkam. Wir waren neun Geschwister, von denen zwei bald starben, und mussten meiner Mutter nach der Schule in der kleinen Landwirtschaft helfen. Vor dem Ziegenstall machte ich immer einen Bogen: denn der eigenartige Gestank behagte mir nicht. Auch brachte ich es von Kindheit an nicht fertig, Geißenmilch zu trinken. Die Gipser tranken damals noch mehr als heute, weil sie jede staubige und schmutzige Arbeit in den alten Häusern zu tun hatten. Es kam vor, dass sie ihren ganzen Verdienst in der Fremde für Wohnung, Essen und Trinken ausgaben und mit nichts im Herbst heimkehrten. In einigen Fällen mussten sie sich sogar das Fahrgeld von zu Hause schicken lassen, um die Zugfahrt bezahlen zu können. Während des Winters arbeiteten die Gipser im Wald oder flochten Weidenkörbe: andere wiederum versuchten als Flickschuster ins neue Jahr hinüberzukommen.
Paul Bäurle, * 1913, Bundesbahninspektor, Deggingen
Die besondere Duftnote
In den 20er Jahren hatte es im cirka 1800 Einwohner zählenden Deggingen einen Ziegen- verein, denn im Ort gab es 280 Geißen und drei Böcke. Meine Eltern besaßen sieben Mutterziegen und betreuten die drei Geißböcke im Stall. Während der Brunstzeit im Oktober mussten wir die Böcke besonders gut füttern, denn in diesen Wochen mussten sie täglich einige Male „ran.“ Das Sprunggeld betrug 20 Pfennig, doch die ärmsten Familien bekamen ihre Ziegen kostenlos gedeckt. Wenn der Bock sich näherte, musste die Ziege am Kopf mit der Halskette festgehalten werden. Die Böcke waren derart aufgeregt, dass man ihnen aus dem Weg gehen musste, um nicht niedergerannt zu werden. Das Fleisch der Kitzlein war sehr begehrt, denn es galt als Delikatesse. Uns Kindern kamen die Tränen, wenn unsere drolligen, auf dem Arm umhergetragenen Spielgefährten geschlachtet wurden. Einmal verfolgte mich der Feldschütz Bernhard Hötzel mit seinem Stock, als mir beim Weiden die Böcke in die aufgegangene Saat gerieten. Die Geißböcke wurden alle paar Jahre gegen junge ausgetauscht, ihr Fleisch vermengte man mit Schweine- und Rindfleisch und verarbeitete es zu hervorragend schmeckenden Hartwürsten. Entlang der Mühlstraße verlief der Bach und trieb die Wasserräder der Mühle und einiger Holzdrechslerbetriebe an. In diesen Bach stürzte einmal eine Ziege, die zwar schwimmen konnte, aber vor Angst jämmerlich schrie, bevor sie dann glücklich von Männern ans Ufer geholt werden konnte. Dass die Geißböcke einen besonderen Duft von sich geben, bemerkte ein Schulbub, als ich mit der Peitsche durchs Dorf knallte. Er bat mich, das Kunststück nachmachen zu dürfen. Ich gab ihm meine Peitsche und musste feststellen, dass eben „die Geschmäcker doch verschieden sind‘, denn bevor er damit zu knallen anfing, führte er den Peitschenstiel an seine Nase und zog unentwegt den Geißbockduft ein, so gut bekam ihm dieser.
Frida Herrmann, * 1914,Hausfrau, Deggingen
Ein langer Firmenname
„Degginger Schröpfkopffabrikation Gebrüder Scherrbacher, Fabrik chirurgischer Instrumente nach dem neuesten technischen Stand“ – so nannte sich die Firma meines Vaters Maximilian und seiner Brüder Ernst, Eugen, Richard und Johannes Scherrbacher. Jeder von ihnen arbeitete für sich allein daheim und stellte die zur Blutabnahme bestimmten Geräte her. Nur bei größeren Aufträgen halfen sie sich gegenseitig. Die Rohware, eine kleines Messinggehäuse, bezogen sie von einer Göppinger Firma. Daraus entstanden Schröpfkopfschnäpper, die je nach Größe bis zu 24 feine Messerchen enthielten und mit Schlagfedern ausgestattet waren. Eine andere Ausführung waren die Pferdeschnäpper, speziell für Tierärzte konstruiert. Außerdem gab es Aderlaßschnäpper, die einem Klappmesser ähnelten. Alle Messer bestanden aus Edelmetall und wurden bei Sonderwünschen in der WMF vernickelt. Der Degginger Buchbinder Max Hagenmaier fertigte die Verpackungen an. Es waren maßgerechte Schächtelchen, die er innen mit Samt ausschlug und kartonweise herstellte. Das Geschäft florierte, und die Schröpfköpfe wurden ins Ausland, teils bis nach Amerika, verschickt, was jedoch mit entsprechendem Risiko verbunden war. Bis die Ware mit dem Schiff die Kunden in Übersee erreichte, vergingen Wochen oder Monate, und wir konnten froh sein, wenn das Geld dafür nach einem halben Jahr glücklich bei uns eintraf. Aufgrund der riesigen Entfernung fühlte sich nicht jeder Geschäftspartner zur Zahlung verpflichtet. Als dann in Tuttlingen ein Betrieb eröffnet wurde, der große Stückzahlen Schröpfköpfe fabrikmäßig produzierte, gingen den Deggingern mit ihren Einmannbetrieben die großen Massenaufträge verloren, Zuletzt blieben nur noch Stammkunden und solche, die bestimmte Einzelanfertigungen verlangten, denn die Wertarbeit der Degginger Schröpfkopfmacher galt als unübertreffbar.
Emil Späth, * 1899, Maler, Deggingen
Heitere Jugend
Früher stand in Deggingen fast vor jedem Haus ein Brunnen, so auch vor dem Schulhaus. Einer von uns Schülern musste täglich dem Lehrer eine Schüssel voll Wasser holen, damit dieser sich die Kreide von den Händen waschen konnte. Die Schulbänke – noch aus Großvaters Zeiten – wiesen Kerben und eingeschnitzte Namen auf. Wir saßen immer zu Vieren in einer Bank, oben an der Tischplatte befand sich eine Rinne für Griffel, Bleistift und Radiergummi, daneben befand sich das Tintengläschen in einer Aussparung fest verankert. Ich besaß einen Bleistift Nr. 2, einen Radiergummi AK und eine weiche Röslesfeder, denn Füller gab es noch nicht. Es war nicht genug, dass der Lehrer Tatzen austeilte, auch der Pfarrer machte von dieser Art der Züchtigung Gebrauch. Um die dabei entstehenden Schmerzen zu lindern, ballten wir nachher immer die Hand möglichst fest zusammen. Zur Musterung schmückten wir Burschen einen Leiterwagen mit Fichtenbäumchen und die Mädchen hängten bunte Papierstreifen daran. Als Sitzplatz dienten Bretter, die wir quer über die Leiterbäume des Wagens gelegt hatten. Wir sangen aus vollem Munde. An unseren Hüten hatten wir schwarz-rot- goldene Bändel, und an diesem Abend gehörten uns die Straßen in Deggingen, denn am Musterungstag durften sich die jungen Männer mehr erlauben als sonst. Ein Glas Bier kostete 10 Pfennig und wir waren froh, endlich einmal einige Groschen mehr ausgeben zu dürfen. Zum fest geplanten Tanzkurs reichte es mir erst nach Kriegsende, wo wir dann Walzer, Marsch, Rheinländer, Schottisch und Francé – eine Art Gesellschaftstanz – lernten.
Klara Späth, * 1904, Näherin, Deggingen
Schröpfköpfe für Freund und Feind
In Deggingen stellte man früher in etwa einem Dutzend Häuser Schröpfköpfe her, die zur Blutentnahme bei Mensch und Tier dienten. Mein Vater Josef Abele hat in unserer Familie mit der Fertigung dieser chirurgischen Instrumente angefangen, die mein Bruder Oskar noch eine Zeitlang weiter betrieb, ehe er zur Bundesbahn ging. Er bezog das rohe Messinggehäuse und stellte die dazu benötigten Messerchen in reiner Handarbeit mit Feile und „Fummel“ (mit Schmirgelpapier überzogener Holzstab) an seiner Werkbank von morgens 5 Uhr bis nachts um 21 Uhr her. Dann wusch er sich, aß noch ein wenig und ging ins Bett, um am anderen Tag frühzeitig aufzustehen und sich wieder seiner Arbeit zu widmen. Wenn wir Kinder nicht folgten, griff er zur Fummel und versohlte uns ordentlich den Hintern. Im Keller stand der Amboss sowie Drehbank und Schleifmaschine mit Fußantrieb. Auch eine Feuerstelle mit Holzkohle befand sich dort, und zur Sauerstoffzufuhr benützte er einen Blasebalg, der ebenfalls mit dem Fuß bedient wurde. Wir lieferten die fertigen Schröpfkopfschnäpper auch ins Ausland, zum Beispiel in die Türkei und nach Polen. Als mein Bruder Oskar im Ersten Weltkrieg durch Polen kam, war er auch in Warschau. An einem freien Tag ging er durch die Straßen der Hauptstadt und las den Firmennamen Malukowitz. Einer unserer dortigen Kunden hieß ebenso, weshalb mein Bruder sich in die Firma begab. Sein Erscheinen als feindlicher deutscher Soldat versetzte die Belegschaft in Furcht und Schrecken. Als er jedoch seinen Ausweis zeigte und auf die Schröpfkopfschnäpper hinwies, wich schlagartig die Angst aus ihren Gesichtern, und die Geschäftsleitung freute sich über alle Maßen und bewirtete ihn reichlich. Meine Mutter fertigte als Modistin Damen- und Herrenhüte an. Der Mode entsprechend wurden die Damenhüte im Sommer mit bunten Seidenbändchen umwickelt und mit Blumen besteckt, im Winter schmückte sie ein Federstrauß. Der Bezug bestand aus Samt, später aus Filz. Bei Trauer wurden die Hüte mit schwarzer Ripsseide überzogen, während der dazugehörende schwarze Schleier das Gesicht bedeckte und hinten bis auf die Schulter reichte. Die Stoffe und Rohhüte kaufte meine Mutter von der Firma Lang, sowie vom Geschäft Veit – Kohn aus Ulm. Ob Mann oder Frau, Sommer oder Winter, früher hat alles Hüte getragen. Sogar die Kinder bekamen zu ihrer Schulentlassung einen Hut als Geschenk. |